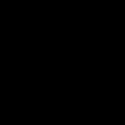Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass die Amazonasregion einst dichter besiedelt war, als bisher angenommen. Nach DNA-Analysen gehen Forscher davon aus, dass vor der Ankunft der Europäer Millionen von Menschen in der heute als Amazonien bezeichneten Region gelebt haben. Die Zahl der Bevölkerung hat dabei schon vor 1500 Höhen und Tiefen erlebt.
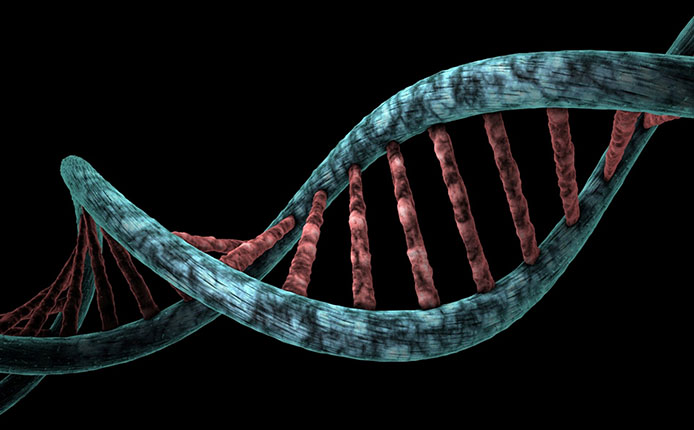
DNA – Foto: Miroslaw Miras auf Pixabay
Wissenschaftler der Universität São Paulo (USP) und der Univeristät Pompeu Fabra in Barcelona haben genetisches Material von 58 verschiedenen Ethnien ausgewertet, um zu ihren Annahmen zu kommen. Danach sollen allein die indigenen Völker, die dem sprachlichen Stamm der Tupi zugeordnet werden, zwischen einer und fünf Millionen Personen umfasst haben. Die Tupis stellen indes nur einen kleinen Teil der indigenen Völker Amazoniens.
Bisherige Studien gehen davon aus, dass in der Amazonas-Region acht Millionen Menschen gelebt haben könnten. Mit den Ergebnissen der neuen Forschung könnte die Zahl allerdings wesentlich höher liegen.
In einer kleinen Population gibt es die Tendenz, dass mehr Menschen die gleichen DNA-Abschnitte haben. Bei großen Populationen geschieht hingegen eher das Gegenteil, wie Marcos Araújo Castro e Silva erklärt, der an der im Wissenschaftsmagazin Molecular Biology and Evolution Studie beteiligt war.
Festgestellt haben die Forscher auch, dass es zwischen den Indios der Anden und der östlichen Amazonas-Region stärkere Vermischungen gegeben hat, als bisher angenommen. Nachweisen konnten die Wissenschaftler ebenso, dass es auch schon vor der Ankunft der Europäer zu einer Verringerung der Population der Tupi-Indios gekommen ist. Die Gründe dafür sind noch ungeklärt.
Mit den DNA-Analysen konnte zudem aufgezeigt werden, dass die Kokama-Indios in Kolumbien, Peru und dem Westen Amazoniens genetisch den Tupi-Völkern nicht nahestehen, auch wenn sie heute zum gleichen Sprachstamm gehören.
Sie müssen im Laufe der Zeit also ihre Sprache gewechselt haben. Angesichts der großen Reiche, die in Amazonien existiert haben, dürfte dieser Prozess wahrscheinlich häufiger gewesen sein, vermutet Tábita Hünemeier, Co-Autorin der Studie.